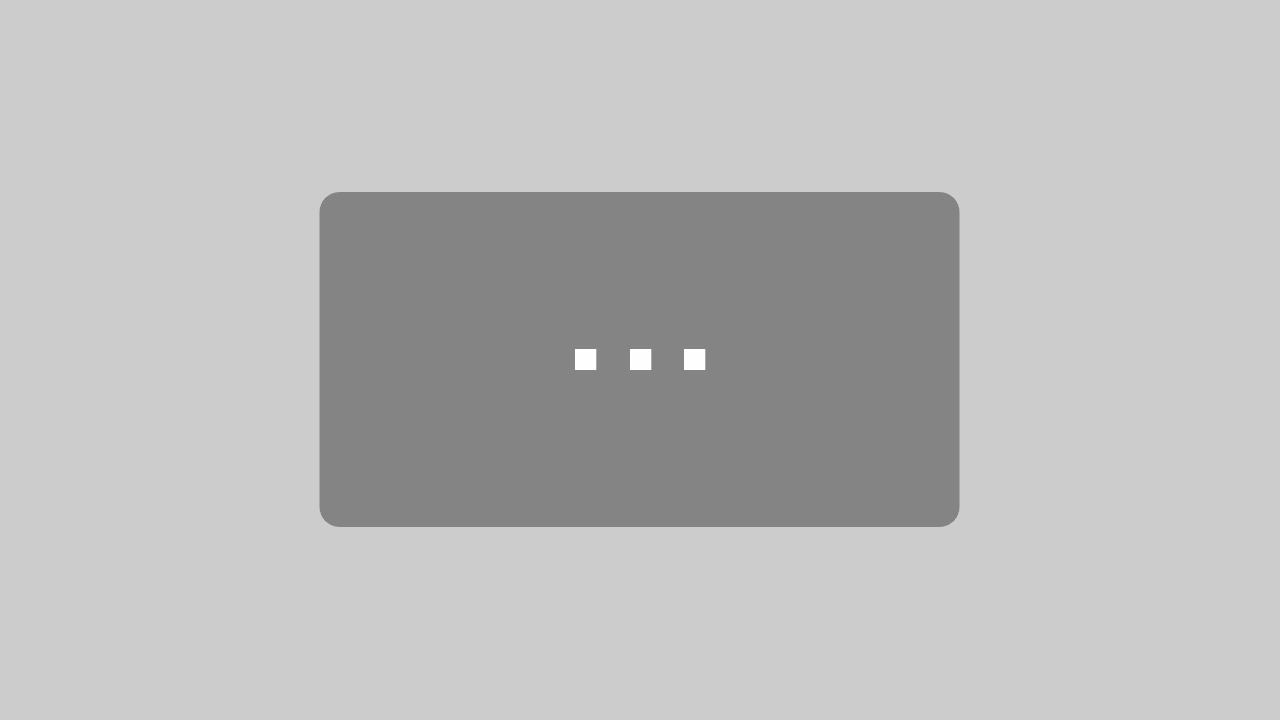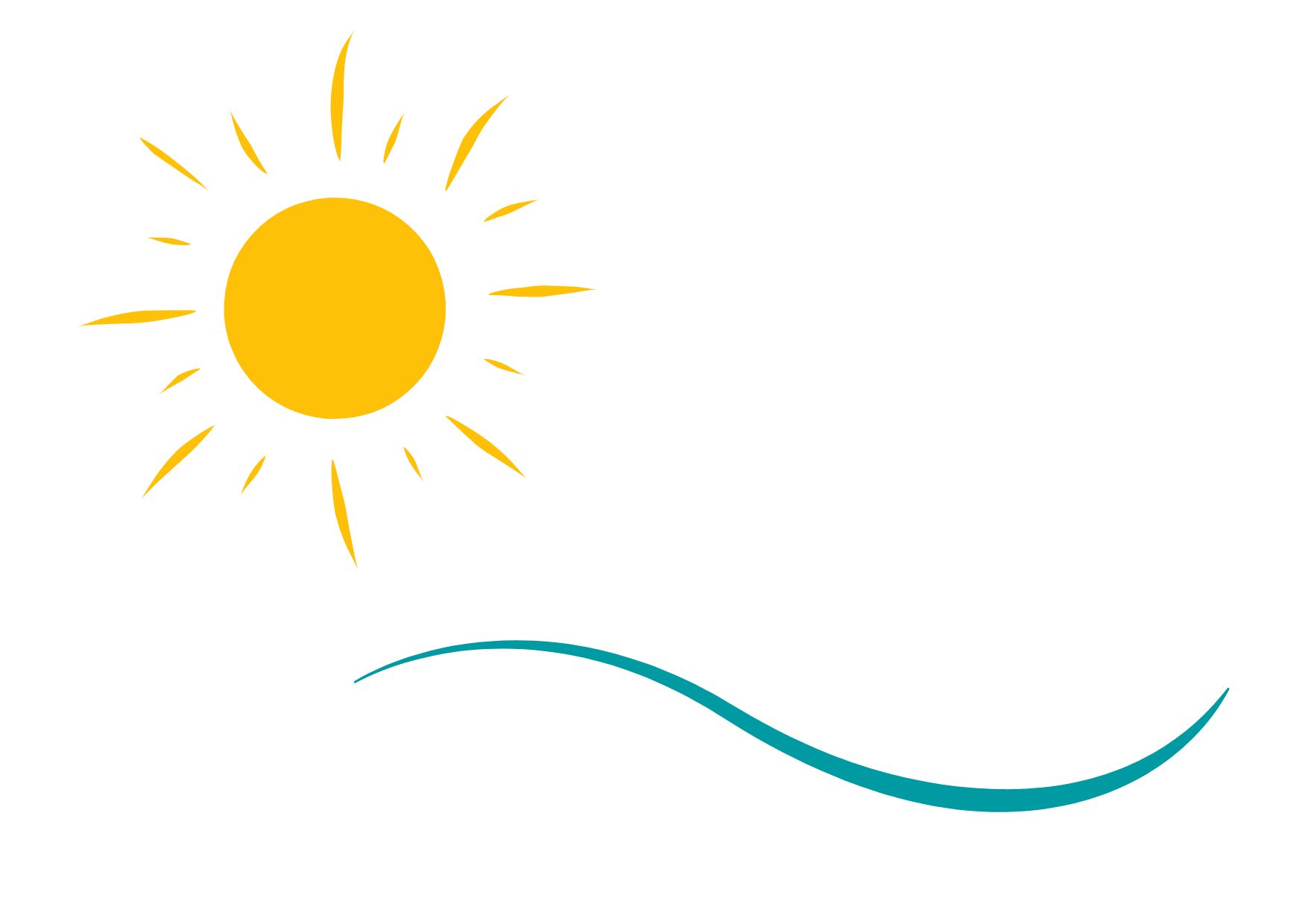Ein innovatives Training für Fachkräfte zur Gesprächsführung im Verdachtsfall sexualisierter Gewalt
„Wir haben eine umfassende Evaluation durchgeführt und festgestellt: Die Teilnehmenden verbessern sich in ihrer Art, Fragen zu stellen, sie verbessern sich in ihrer Art, das Kind emotional zu unterstützen. Sie fühlen sich viel selbstwirksamer im Anschluss und trauen sich viel mehr selbst zu, solche Gespräche zu führen.“
(Elsa Gewehr und Anett Tamm von der Psychologischen Hochschule Berlin)
Zum Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt am 18.11.2024 möchten wir auf ein möglicherweise zukunftsweisendes Trainingsprogramm aufmerksam machen.
Passend zum Motto des Tages, der sich dieses Jahr um Chancen und Grenzen von neuen Technologien dreht, bietet das Programm pädagogischen Fachkräften eine praxisnahe Möglichkeit, sich in einem virtuellen Setting gezielt auf eine sensible Gesprächsführung vorzubereiten, wenn sie sexualisierte Gewalt vermuten. Es wurde im Verbunds-Forschungsprojekt ViContact für Lehrkräfte sowie Kinderschutzfachkräfte entwickelt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Kürzlich haben wir ja unter Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe aktuelle Bedarfe und Fragestellungen erfasst. Eines der zentralen Ergebnisse: Das Bedürfnis nach Handlungssicherheit und Informationen zur Gesprächsführung im Verdachtsfall ist groß. Hier scheint es im professionellen Kontext eine Lücke zu geben, dabei ist die Rolle der Fachkräfte bei der Aufdeckung von sexualisierter Gewalt mitunter sehr bedeutsam:
Pädagogische Fachkräfte können die ersten Erwachsenen außerhalb der Familie sein, die Anzeichen von Belastung oder Notlagen bei Kindern und Jugendlichen wahrnehmen, beispielsweise plötzliche Verhaltensänderungen, Leistungsabfall oder sozialen Rückzug. Solche Symptome können aber viele Ursachen haben. In diesen Momenten kommt es deshalb auf eine wertfreie, unterstützende und ergebnisoffene Gesprächsführung und entsprechende Fragetechniken an. Nur so können Kinder und Jugendliche sich öffnen und weitere Schritte eingeleitet werden, ohne dass die Situation durch Vorannahmen oder suggestive Fragen beeinflusst wird.
Das ViContact-Training, das von der Psychologischen Hochschule Berlin unter der Leitung von Prof. Renate Volbert gemeinsam mit der Universitätsmedizin Göttingen unter der Leitung von Prof. Jürgen Müller und der Europa-Universität Flensburg unter der Leitung von Prof. Simone Pülschen entwickelt wurde, nimmt diese Fragetechniken in den Blick. Es kombiniert ein fundiertes E-Learning-Modul mit einem innovativen Virtual-Reality-Training. Im E-Learning-Modul vermitteln Videos, Wissensinhalte und Übungsaufgaben die Grundlagen der unterstützenden Gesprächsführung. Die Teilnehmenden wechseln dann in ein Virtual-Reality-Setting, in dem sie mithilfe von simulierten, kindlichen Gesprächspartner*innen Gesprächstechniken einüben und gezielt Feedback zu ihrer Gesprächsführung erhalten. Hierbei geht es ausschließlich um Erstgespräche, in denen ermittelt werden soll, ob es weiteren Handlungsbedarf gibt. Aktuell steht dieses Setting nur im Labor in Berlin zur Verfügung, künftig sollen Einrichtungen es auch für den lokalen Einsatz buchen können.
Das ViContact-Training kann ein praxisnahes Werkzeug für Fachkräfte werden, die in ihrem Arbeitsalltag auf herausfordernde Gesprächssituationen und mögliche Verdachtsfälle vorbereitet sein wollen. Das Projekt befindet sich in der Abschlussphase, in der Folge soll ein Kompetenzzentrum eingerichtet werden. Für pädagogische Fachkräfte wird das Training voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 zur Verfügung stehen – wir sind sehr gespannt darauf und halten Sie auf dem Laufenden.
Wir haben uns mit den Entwicklerinnen und Psychologinnen Elsa Gewehr und Anett Tamm von der Psychologischen Hochschule Berlin über das Projekt unterhalten.
Hinweis: Der Fokus des Trainings liegt auf den grundlegenden Fähigkeiten zur Gesprächsführung für ein Erstgespräch, das auf eine mögliche Offenlegung abzielt. Mit Blick auf den Komplex der Intervention bei Anhaltspunkten auf / im Fall von sexualisierter Gewalt sind die Definition von Verantwortlichkeiten und Verfahrensabläufen beim Einschreiten und ein bedachtes, kooperatives Vorgehen unerlässlich. Dazu können Sie sich hier weitergehend informieren.
PsG.nrw: Was genau war das Ziel des Forschungsprojekts?
Ziel war die Entwicklung und Evaluation eines Trainingssystems, um Personen, die in der Praxis Gespräche mit Kindern zur Abklärung von Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs führen (wir benutzen meist diesen strafrechtlichen Begriff), in der konkreten Gesprächsführung zu trainieren. Dabei geht es immer um Erstgespräche in einem solchen Verlauf.
Wir konzentrieren uns dabei auf die Frage: Wie kann man mit Kindern die Gespräche so führen, dass die Kinder sich sicher genug fühlen, sich jemandem zu öffnen und zu erzählen, was sie erlebt haben? Sie sollen optimal darin unterstützt werden, ihr autobiografisches Gedächtnis abzurufen. Es soll vermieden werden, sie so zu beeinflussen, dass falsche Informationen zutage treten oder es langfristig eine Veränderung von Gedächtnisinhalten geben kann.
PsG.nrw: Woraus besteht das Programm und wie läuft es ab?
Aktuell besteht es zum einen aus einem E-Learning-Programm. Das umfasst etwa 10 Stunden und besteht unter anderem aus Lehrvideos und praktischen Übungen, zum Beispiel zur Gesprächsführung mit Kindern, dazu, wie Kinder sich erinnern, zu sexualisierter Gewalt im Allgemeinen etc. Die Teilnehmenden können beispielsweise üben, Fragen so zu formulieren, dass sie für die Kinder emotional unterstützend sind.
Dann gibt ein Präsenztreffen mit uns beiden und der Teilnehmendengruppe. Da können alle möglichen Themen besprochen werden, die sich in diesem E-Learning-Format nicht so gut umsetzen lassen. Beispielweise wenn die Teilnehmenden aus ihrer beruflichen Praxis bestimmte Konstellationen kennen, die wir in unserem E-Learning nicht abgedeckt haben.
Wir führen auch noch mal praktische Übungen anhand von realen Fallbeispielen durch.
Die Gruppe besteht aus zehn bis maximal 20 Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Diese sollen sich miteinander vernetzen und in Kontakt kommen.
Danach folgen die Übungsgespräche in der virtuellen Realität. Aktuell kommen die Teilnehmenden dafür zu uns ins Labor. Für die Zukunft hoffen wir, dass wir unser System auch vor Ort anbieten können.
Hier werden dann Gespräche mit virtuellen Kindern geführt und die Teilnehmenden erhalten dazu Feedback.
Abschließend gibt es ein Supervisionsmodul, welches wir jedoch noch nicht in der Praxis getestet haben. Das soll die Brücke schlagen zum beruflichen Alltag der Teilnehmenden. Im Supervisionsmodul haben sie die Möglichkeit, uns anonymisiert Protokolle von eigenen Gesprächen zu übermitteln, und wir geben Feedback zur Gesprächsführung, also zur Art der Fragen, ob Unterstützung gegeben wurde, ob bestimmte Dinge am Anfang und im Verlauf berücksichtigt wurden.
PsG.nrw: Wie sehen die Gespräche aus?
Die Gespräche dauern zehn Minuten und finden in einem 3-D-Setting statt, die Teilnehmenden tragen eine VR-Brille. Die Gesprächssituation ist so: Man sitzt mit dem Kind im Klassenraum. Es ist eine zehnminütige Hofpause, alle anderen Kinder sind draußen. Und das Kind kommt auf einen zu oder man soll das Kind ansprechen.
Die Teilnehmenden lesen vorher eine Fallvignette über ein Kind, sein Befinden und sein Lebensumfeld, in dem ein Verdachtsmoment aufgekommen ist.
Dann erhalten sie die Aufgabe, das Kind zu befragen, um herauszufinden, was passiert ist. Sie können das Kind in der virtuellen Realität verbal befragen und das Kind antwortet weitgehend passend auf die Fragen, die man gestellt hat.
Die Kinder öffnen sich nur dann und berichten nur dann akkurat, was ihnen „passiert“ ist, wenn sie mit den Methoden und mit den Fragetechniken befragt werden, die die Teilnehmenden vorher im E-Learning gelernt haben.
Im Anschluss an die Gespräche bekommen die Teilnehmenden automatisiertes Feedback zu ihrer individuellen Gesprächsführung. Zum Beispiel wird zurückgespielt, wie viele zielführende oder weniger zielführende Fragen sie gestellt haben und welche Arten von Fragen das waren.
Die Teilnehmenden bekommen einige ihrer Fragen noch einmal schriftlich angezeigt und sehen einen kleinen Text zu der Fragekategorie und den Auswirkungen dieser Art von Fragen. Je nachdem werden sie dazu ermutigt, davon mehr zu stellen oder sie zu vermeiden. So können sie sich über die Gespräche hinweg verbessern.
PsG.nrw: Wie können wir uns diese virtuellen Kinder genau vorstellen?
Die virtuellen Kinder sehen schon computergeneriert aus, es sind also keine fotorealistischen Gestalten. Wichtig sind die einprogrammierten Gedächtnisinhalte zu verschiedenen Themen, die sie dann, wenn man sie fragt, freigeben können.
Sie sind um die zehn Jahre alt. Die besonderen Herausforderungen mit besonders jungen Kindern konnten in diesem Pilotprojekt noch nicht umgesetzt werden.
Wir haben gleichermaßen Jungen wie Mädchen. Dann ist z. B. ein Kind dabei, das nicht so gut sehen kann, und eines hat einen Migrationshintergrund.
Die Kinder haben allgemeine Gedächtnisinhalte zu Familie, Schule, Freundschaften, aber auch zu jeweils einem kritischen Erlebnis, um das es in dem Gespräch zentral gehen soll. Diese Erlebnisse können aus drei Bereichen kommen: Es kann ein Erlebnis sexualisierter Gewalt sein, es kann aber auch ein anderes Erlebnis sein, welches interventionsbedürftig ist. Sprich eine andere Kindeswohlgefährdungslage oder Form von Vernachlässigung. Oder es kann etwas sein, das zwar belastend für das Kind war, aber keiner direkten Intervention durch eine erwachsene Person bedarf, z. B. eine Auseinandersetzung mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin. Jedes virtuelle Kind, mit dem man sich unterhält, hat immer nur eines von diesen drei Ereignissen erlebt.
Die Aufgabe ist es dann, mit dem Kind zu sprechen und herauszufinden, was passiert ist. Wir haben diese drei Varianten entwickelt, weil wir das Anliegen haben, auch zu vermitteln, dass Teilnehmende ergebnisoffen befragen sollen. Es geht nicht nur darum herauszufinden, ob beispielsweise ein sexueller Missbrauch vorliegt oder nicht, sondern sie sollen lernen, den Kindern zuzuhören und so die Information zu erhalten, was bei ihnen vorgefallen ist.
Die Interaktion mit den Kindern funktioniert so, dass man ihnen eine Frage stellt, die aufgenommen und auf verschiedenen Ebenen kategorisiert wird, beispielsweise wird zwischen erwünschten und unerwünschten Fragekategorien unterschieden. Erwünschte Fragen sind zum Beispiel Erzählaufforderungen oder Formen aktiven Zuhörens. Unerwünschte Fragen sind Suggestivfragen, aber auch Ja-Nein-Fragen, Auswahlfragen oder unverständliche Fragen.
Im Hintergrund gibt es einen komplexen Algorithmus, der basierend auf der kategorisierten Frageform und dem Inhalt der Frage bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Antwort ausgegeben wird. Dieser Algorithmus wurde nach Forschungserkenntnissen dazu programmiert, wie Kinder antworten, wenn sie die verschiedenen Arten von Fragen gestellt bekommen.
Es sind aber auch unsere praktischen Erfahrungen aus eigenen Befragungen mit eingeflossen und letztlich auch ein paar didaktische Überlegungen.
Das Gespräch ist nach 10 Minuten zu Ende, kann auch selbstständig beendet werden. Dann bekommen die Teilnehmenden das Feedback dazu.
Dadurch, dass die Kinder auch ganz viel allgemeines Wissen besitzen, kann man beim Gesprächseinstieg auch über andere Dinge mit ihnen sprechen. So besteht die Möglichkeit, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern den Einstieg neutral oder positiv zu gestalten.
Außerdem haben wir zwei Varianten umgesetzt: Es gibt Kinder, die kommen von sich aus auf die Gesprächspartner*in zu und sagen: „Haben Sie ein Moment Zeit für mich? Ich möchte gern was erzählen.“ Hier ist die Aufgabe, das aufzugreifen und aktiv zuzuhören. Da sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das Kind einer erwachsenen Person etwas Relevantes sagt, höher.
Und dann haben wir die Variante, in der es eine Auffälligkeit gibt. Bei der Variante ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder gleich was Relevantes sagen, geringer. Denn wie im wahren Leben haben sich die Kinder ja noch gar nicht dafür entschieden, sich zu offenbaren. Da ist es wichtig, dass die Teilnehmenden erst einmal unterstützend fragen, sodass die Kinder merken: Mit der Person kann ich mich unterhalten, die ist auch in der Lage, sich das anzuhören. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit für informative Antworten je nachdem, wie gut gefragt wird und ob unterstützende Techniken angewandt werden.
So kann ein möglichst realistisches Gespräch mit diesen virtuellen Kindern geführt werden.
Die Teilnehmenden bekommen nach einer gewissen Zeit einen Hinweis, dass das Gespräch jetzt nahezu zu Ende ist. Und dann wissen sie: Spätestens jetzt sollten sie, wenn sie etwas herausgefunden haben, noch fragen, ob das Kind schon mit jemandem darüber gesprochen hat, ob das Vorgefallene aktuell ist und wie häufig es passiert ist. Haben sie alle Informationen, die notwendig sind, um einzuschätzen, wie hoch der Handlungsbedarf ist?
PsG.nrw: Wie gehen Sie um mit Teilnehmenden, die selbst Betroffene sind?
Teilnehmende werden zu Beginn über die Inhalte des Trainings informiert und können das Gespräch abbrechen, falls es emotional zu belastend wird. Im Praxistest war dies bislang nicht nötig. Die Teilnahme an dem Training ist zudem immer freiwillig.
Und dann findet dieses virtuelle Setting ja innerhalb der Realität statt. Die Person hat die VR-Brille auf dem Kopf, und eine ViContact-Mitarbeiterin, die das System steuert, sitzt mit im Raum und bekommt auch mit, wenn es emotional belastend wird. Sie könnte eingreifen und ist ansprechbar. Auch im Anschluss können solche emotionalen Belastungen noch besprochen werden. Bei der größeren Evaluationsstudie, die wir durchgeführt haben, wurde optional eine professionelle psychologische Beratung im Anschluss an die VR-Gespräche angeboten, falls sich jemand belastet fühlt. Das wurde aber von den Teilnehmenden nicht in Anspruch genommen.
Die Frage rührt sicher auch von der Vorstellung her, dass diese virtuellen Gespräche sehr belastend sein können. Vielleicht gibt es da eine falsche Vorstellung darüber, wie intensiv und im Detail sexualisierte Gewalt besprochen wird. Die Kinder haben ja vordefinierte Sätze zu dem, was sie erlebt haben. Das sind alle möglichen Sätze über verschiedene Bereiche des Lebens sowie über einen potenziell problematischen Bereich. Und einige Kinder, die so programmiert sind, dass sie sexuellen Missbrauch erlebt haben sollen, sagen eben auch Sätze zu sexuellem Missbrauch. Die sexuellen Handlungen an sich werden nicht sehr detailliert besprochen.
Dieses Training – das ist ein wichtiges Merkmal – ist ausgerichtet auf Erstgespräche. Und in denen geht es anders als in forensischen Gesprächen (also bei der Polizei, vor Gericht oder in der Begutachtung) erst einmal darum herauszufinden, ob es überhaupt Handlungsbedarf gibt und wie dieser ungefähr aussehen kann. Dafür müssen die Lehrkräfte und auch die Fachkräfte nur so viel wissen, dass sie einschätzen können: Ist es sexualisierte Gewalt, ist es eine sonstige Form von Kindeswohlgefährdung oder ein anderes interventionsbedürftiges Ereignis?
Und: Ist das Kind aktuell in Gefahr, von wem geht die potenzielle Bedrohung aus, wie häufig ist es schon passiert, hat das Kind mit jemandem gesprochen?
Ist für die Teilnahme an dem Training ein gewisses Vorwissen erforderlich?
Man braucht kein Vorwissen, man bekommt wesentliches Wissen im E-Learning vermittelt und kann es dann anwenden. Das Training ist so aufgebaut, dass grundlegende Fähigkeiten zur Gesprächsführung vermittelt werden, die übergreifend in verschiedenen Bereichen gelten.
PsG.nrw: Müssen Einschätzungen nicht eher im Team vorgenommen werden?
Tatsächlich wurde von den Teilnehmenden vor allem aus dem Bereich Jugendamt auch angemerkt, dass man solche Gespräche eigentlich nicht allein durchführen würde, wenn man schon etwas weiß. Aber der Fokus liegt bei uns ja auf dem Erstgespräch, das auf eine mögliche Offenbarung abzielt, und auf dem Erwerb der Fähigkeiten zur Gesprächsführung. Deshalb ist hier nur eine Eins-zu-eins-Situation dargestellt.
Die trainierende Person soll diese grundlegenden basalen Fähigkeiten zur Gesprächsführung lernen und üben können.
PsG.nrw: Wie kann gewährleistet werden, dass sich die Lerninhalte verfestigen und im Alltag angewendet werden können?
Einmal dadurch, dass die Teilnehmenden mehrere Durchgänge haben, in denen sie das Feedback, das sie bekommen haben, gleich umsetzen, üben und festigen können. Auch im Präsenztermin wird eine Kopplung zum Arbeitsalltag der Teilnehmenden hergestellt. Wir laden da auch sehr stark dazu ein, über herausfordernde Gesprächssituationen aus dem eigenen beruflichen Alltag zu berichten.
Beim letzten Mal hatten wir verschiedene Professionen im Kurs, sodass die Teilnehmenden auch voneinander etwas lernen konnten.
Und dann gibt es noch das Supervisionsmodul, das konkret auf den Transfer des gelernten Wissens in die Praxis abzielt.
Was wir bisher von den Teilnehmenden aus dem Kinderschutz nach dem ersten Praxistest gehört haben, war, dass sie nach dem Training gleich die ersten allgemeinen Gespräche mit Kindern, auf ganz andere Art und Weise geführt haben. Und dass sie verblüfft waren, wie viel sie von den Kindern erfahren haben. Das waren Gespräche zu allen möglichen Themen, gar nicht zu sexualisierter Gewalt, sondern zum Beispiel dazu, wie es in der Schule läuft. Die Teilnehmenden berichteten, dass sie da normalerweise wenig erfahren: Wie war es in der Schule? Gut, schlecht, naja … Da kommt nicht so viel. Jetzt haben sie angefangen, diese offenen Erzählaufforderungen, die wir ihnen beibringen, viel mehr mit einzubringen und zu zeigen, dass sie sich wirklich für das Kind interessieren. Sie fragen nicht mehr einfach, war es gut in der Schule, sondern: Mensch, ich interessiere mich total dafür, wie es bei dir in der Schule läuft – erzähl mir doch mal, wie heute der Tag war. Und dann fragen sie weiter, mit offenen Erzählaufforderungen.
Der nächste Schritt ist jetzt zu gucken, ob der Trainingserfolg auch über einen längeren Zeitverlauf, zum Beispiel drei Monate, stabil bleibt.