Rehabilitationsverfahren im Rechte- und Schutzkonzept
Unter vielen Fachkräften kursiert die Sorge, dass sie in der pädagogischen Praxis zu Unrecht mit Vorwürfen von (sexualisierter) Gewalt konfrontiert werden könnten. Das führt mitunter zu Verunsicherungen, insbesondere im Hinblick auf ein professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz im pädagogischen Alltag. Fälle von tatsächlichen Falschbeschuldigungen kommen in der Praxis selten vor, aber die Angst davor bedarf einer Bearbeitung.
Für Organisationen empfiehlt sich darum die Erarbeitung eines sogenannten Rehabilitationskonzepts zur Wiederherstellung der Reputation der fälschlich angeschuldigten Person und zu ihrer Reintegration in die Organisation und pädagogische Tätigkeit.
Die mögliche Rehabilitation einer falsch beschuldigten Person ist Teil des gesamten organisationalen Aufarbeitungsprozesses, welcher sich an eine Fallbearbeitung anschließt.
Wichtig: Ein abgeschlossenes Interventionsverfahren sowie eine transparente und fachlich angemessene Abklärung des Verdachts sind für den Start eines Rehabilitationsprozesses unerlässliche Voraussetzungen. Es findet lediglich Anwendung, wenn im Rahmen des Interventions- und Klärungsprozesses nachgewiesen werden kann, dass sich der Verdacht gegenüber dem*der angeschuldigten Mitarbeiter*in zweifelsfrei als unbegründet herausgestellt hat.
Der Rehabilitationsprozess mit unterschiedlichen Akteur*innen der Organisation
Fälle sexualisierter Gewalt sind individuell und bedürfen daher auch einer individuellen Bearbeitung. Die im Folgenden skizzierten Handlungsschritte sind darum nicht als Schema zu betrachten, welches in jedem Fall so berücksichtigt werden muss. Sie dienen vor allem der Orientierung und zeigen auf, welche Ebenen innerhalb des Rehabilitationsprozesses bezogen auf falsch beschuldigte Mitarbeiter*innen berücksichtigt werden müssen.
Bei einem anstehenden Rehabilitationsverfahren übernimmt die Leitung die Koordination. Je nach Konstellation wird die Personalabteilung sowie die Mitarbeiter*innenvertretung hinzugezogen. Um Fachlichkeit zu gewährleisten, empfiehlt sich vor allem die Hinzunahme von externer Prozessbegleitung (z.B. Supervision).
Der Rehabilitationsprozess mit der falsch beschuldigten Person
Bezogen auf die falsch beschuldigte Person müssen zwei Aspekte bedacht werden: die (arbeitsrechtlichen) Formalia sowie die persönliche Aufarbeitung. Folgende Schritte können dabei relevant sein.
(Arbeits-)Rechtliche Aspekte:
- Sind (vorübergehende) arbeitsrechtliche Maßnahmen wie Freistellung, Suspendierung, Beurlaubung etc. erfolgt und können diese aufgehoben werden?
- Existieren, bezogen auf den Fall, Einträge in der Personalakte und können diese gelöscht werden?
- Sind bei der falsch beschuldigten Person Kosten entstanden, die durch Arbeitgeber*innen erstattet werden müssen (z.B. durch Straf- oder Arbeitsrechtsverfolgung)?
- Bestehen Ansprüche auf Entschädigung oder Schadensersatz (z.B. durch Lohnausfall)?
- Benötigt die falsch beschuldigte Person rechtlichen Beistand?
Für Arbeitgeber*innen ist es an dieser Stelle empfehlenswert arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung hinzuzuziehen.
Persönliche Aufarbeitung:
Zwischen einem Anfangsverdacht und der zweifelsfreien Feststellung, dass der Verdacht unbegründet war, vergeht unter Umständen einige Zeit, in der die falsch angeschuldigte Person mitunter hohem psychischem Druck ausgesetzt ist. Insbesondere für Pädagog*innen ergeben sich neben den Fragen der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung vor allem auch Zukunftssorgen, inwiefern sie ihren Beruf weiter ausüben können.
Um die Person auf emotional-psychischer Ebene zu entlasten und um eine Wiederaufnahme der Tätigkeit zu ermöglichen, ist deshalb die Unterstützung durch Supervision oder psychologische Beratung zu empfehlen. Arbeitgeber*innen sollten auch an dieser Stelle prüfen, inwiefern sie Mitarbeiter*innen, ggf. auch finanziell, unterstützen können.
- Welche psychischen Belastungen sind entstanden? Welche Entlastungsstrategien können gefunden werden?
- Welche Sorgen/Ängste haben sich (in Bezug auf das Fortsetzen der Tätigkeit) entwickelt?
- Welche Folgen hat der Vorfall für die pädagogische Tätigkeit insgesamt?
- Wie geht die Person zukünftig in Nähe-Verhältnisse mit Kindern und Jugendlichen?
Die Reintegration in die Organisation und pädagogische Tätigkeit ist das Ziel. Je nach Fall und Dynamik innerhalb der Organisation variiert die Wahrscheinlichkeit, dass dies überhaupt möglich oder gewünscht ist. Falls eine Wiedereingliederung (aufgrund unterschiedlicher Faktoren) nicht möglich ist, müssen Arbeitgeber*innen prüfen, inwiefern sie die falsch angeschuldigte Person anderweitig unterstützen (z.B. durch das Angebot eines Einrichtungswechsels, Unterstützung bei der Bewerbung etc.).
Der Rehabilitationsprozess mit dem Team und den direkten Kolleg*innen
Damit die Rehabilitation einer falsch beschuldigten Person gelingen kann, muss insbesondere die Ebene der direkten Kolleg*innen beziehungsweise des Gesamtteams mitgedacht werden.
Die Leitfrage für das Team lautet: Was ist notwendig, damit zur falsch beschuldigten Person wieder Vertrauen hinsichtlich ihrer pädagogischen Professionalität gefasst werden kann? Das Team muss ausreichend Zeit und Raum einplanen, um daran zu arbeiten.
Verbunden mit dem Verdachtsfall sexualisierter Gewalt sind im gesamten Team der Organisation ebenfalls Belastungen und Emotionen entstanden, die bearbeitet werden müssen. Das Risiko der Team-Spaltung ist in solch einem Fall sehr groß, da die Mitglieder in der Regel unterschiedliche Perspektiven sowohl auf den Fall selbst als auch auf die falsch angeschuldigte Person haben.
Es ist hilfreich, wenn die Leitung gegenüber dem Team den gesamten Fall noch einmal transparent rekonstruiert und chronologisch aufzeigt, durch welche Schritte und Maßnahmen zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass es sich um eine Falschbeschuldigung handelt. Die professionelle Klärung von Verdachtsfällen und die transparente Weitergabe von Informationen zum Geschehen erhöht die Chance im Team, dass das Vertrauen in die pädagogische Professionalität der falsch beschuldigten Person wieder wachsen kann.
Im Rahmen der weiteren Bearbeitung braucht es Raum für die Sorgen, Ängste, Wut oder andere Emotionen, die durch die Situation bei den einzelnen Mitarbeitenden entstanden sind. Externe Moderation sowie supervisorische Begleitung sind auch an dieser Stelle besonders empfehlenswert. Je nach Fall und Konstellation sind möglicherweise sogar mehrere Sitzungen notwendig, um dem Team den Raum zu geben, den es braucht.
Die Rehabilitation einer falsch beschuldigten Person ist ein Prozess, der vor allem auf der kognitiv-emotionalen Ebene der Beteiligten stattfindet. Dabei kann zum Beispiel Folgendes erörtert werden:
- Aus persönlicher Sicht: Was benötigt das Team, um Vertrauen herzustellen oder wiederaufzubauen?
- Aus fachlicher Sicht: In welche Situationen könnte die zu Unrecht beschuldigte Person zukünftig kommen, in denen der Verdacht eine Rolle spielt? Wie kann das Team damit umgehen?
- Wechsel der Perspektive: Was wünscht sich ein*e Mitarbeiter*in, die unbegründet in den Verdacht der Gewaltausübung geraten ist?
- Welche Konsequenzen für die pädagogische Praxis zieht das Team aus diesem Fall? Muss das Rechte- und Schutzkonzept überarbeitet werden (z.B. durch die Erweiterung der geltenden Verhaltensleitlinien)?
An dieser Stelle ist noch einmal zu prüfen, ob es einzelne Mitarbeiter*innen gibt, die gesonderte Gespräche benötigen (z. B. weil sie eine tragende Rolle bei der Intervention innehatten oder sie nachhaltig belastet sind). Dieses Angebot sollte ebenfalls aktiv durch die Leitung kommuniziert werden.
Es ist abzuwägen, inwiefern die Erarbeitungen gemeinsam oder zunächst getrennt zwischen Team und falsch angeschuldigter Person erfolgen. Im weiteren Verlauf kann es hilfreich sein, wenn es gemeinsame Gespräche gibt, in denen z.B. gegenseitige Erwartungen formuliert sowie Vereinbarungen an und für die weitere Zusammenarbeit getroffen werden.
Inwiefern eine Rehabilitation innerhalb der Gesamtorganisation notwendig ist, muss geprüft werden. Hierbei sind insbesondere die Persönlichkeitsrechte sowie der Datenschutz der falsch beschuldigten Person zu wahren.
Der Rehabilitationsprozess auf Team-Ebene sowie die (fachliche) Aufarbeitung des Falls sind für den zukünftigen Umgang mit Verdachtsfällen von (sexualisierter) Gewalt sehr wichtig. Sollten Ängste bei Mitarbeitenden verbleiben, besteht das Risiko, dass sie anlässlich eines weiteren Verdachts aus Unsicherheit untätig bleiben.
Der Rehabilitationsprozess mit Kindern und Jugendlichen
Je nach Fall sind auch die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung über den Fall informiert. Dabei kann ihr Informationsstand unterschiedlich konkret und umfangreich sein. In jedem Fall bekommen Kinder und Jugendliche mit, dass ein Klärungsprozess innerhalb der Einrichtung läuft, weil sie z.B. merken, dass die Erwachsenen in Aufregung sind oder dass ein*e Mitarbeiter*in nicht mehr da ist. Ist die Situation geklärt und der Verdacht zweifelsfrei ausgeräumt, müssen Maßnahmen der Rehabilitation auch auf dieser Ebene erfolgen. Diese können zum Beispiel (je nach Einrichtung und Handlungsfeld) verschiedene Gesprächsformate beinhalten:
- Eine zielgruppengerechte Kommunikation: Über den Fall, unter Berücksichtigung des Alters- und Entwicklungsstandes der jungen Menschen sowie ihres Kenntnisstandes. Die Hinzunahme externer Beratung bezüglich der zu treffenden Wortwahl und der geteilten Inhalte empfiehlt sich hier.
- Raum für Gedanken und Emotionen der Kinder und Jugendlichen schaffen: Gibt es Ängste, Sorgen oder Unsicherheiten in Bezug auf den Fall?
- Wechsel der Perspektive: Wurden Kinder und Jugendliche schon einmal für etwas beschuldigt, das sie nicht getan haben? Was haben sie sich gewünscht, wie die anderen damit umgehen?
- Gesprächsangebote machen: Die Erwachsenen machen Angebote zu Einzelgesprächen, um über Inhalte zu sprechen, die Kinder und Jugendliche nicht in der Gruppe teilen möchten.
Der Umgang mit falsch beschuldigenden Personen
An dieser Stelle muss grundsätzlich differenziert werden zwischen dem Umgang mit Erwachsenen/Fachkräften und dem Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die falsche Anschuldigungen tätigen.
Fachkräfte
Unbegründete Verdachtsmomente in Fällen von (sexualisierter) Gewalt kommen aus unterschiedlichen Gründen zu Stande, nicht nur durch bewusst falsche Anschuldigungen, wie es häufig angenommen wird. Wenn ein falscher Verdacht entstanden ist, in dessen Rahmen zum Beispiel (im Rahmen des Interventionsprozesses) Kommunikation unzureichend gewesen ist oder Schritte zur Klärung nicht eingehalten wurden, ist der Fall fachlich zu reflektieren und aufzuarbeiten.
Hierbei steht die Frage im Vordergrund: Durch welche Umstände/Konstellationen ist es dazu gekommen, dass Mitarbeiter*in XY fälschlich im Verdacht stand, sexualisierte Gewalt ausgeübt zu haben?
Wie bereits oben beschrieben, sind Maßnahmen im Rehabilitationsprozess bezogen auf das Team zu unternehmen. Im Besonderen ist dann noch einmal zu prüfen, inwiefern es Personen im Prozess gab, die maßgeblich am Zustandekommen der Falschanschuldigung beteiligt waren. Für den Rehabilitationsprozess ist es wichtig, dass sie in die Verantwortung genommen werden:
- Welche Erklärung haben sie für das Zustandekommen der Falschbeschuldigung?
- Muss die Übernahme von Verantwortung teamintern kommuniziert werden?
- Muss eine Entschuldigung (auch schriftlich) erfolgen?
- Ist weitergehend eine Mediation o.Ä. für die Zusammenarbeit zwischen falsch beschuldigender und falsch angeschuldigter Person erforderlich?
Gleiches gilt für Personen, die bewusst falsche Anschuldigungen tätigen, um die andere Person zu schädigen. In diesem Fall sind darüber hinaus straf- und arbeitsrechtliche Maßnahmen möglich.
Kinder und Jugendliche
Auch Falschanschuldigungen unter Kindern und Jugendlichen können aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Es ist daher zunächst zu erörtern, wie es zu den falschen Anschuldigungen gekommen ist. Je nach Alter und Entwicklungsstand muss der Fall mit ihnen aufgearbeitet werden und müssen sie ebenso in die Verantwortung genommen werden:
- Welche Hintergründe hat die Falschanschuldigung/Gab es eine bestimmte Motivation?
- Ist eine (schriftliche) Entschuldigung aus pädagogischer Sicht sinnvoll? Müssen sie dabei unterstützt werden?
Für Kinder und Jugendliche, die Mitarbeitende falsch beschuldigen, besteht weiterhin grundsätzlich eine pädagogische Verpflichtung und je nach Fall muss erörtert werden, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind, damit eine pädagogisch angemessene Beziehungsgestaltung wieder möglich wird.
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen empfiehlt es sich, Kinder und Jugendliche, die falsche Beschuldigungen geäußert haben, an spezialisierte Fachberatungsstellen oder Kinder- und Jugendtherapeut*innen anzubinden. Es ist zum Beispiel möglich, dass diese Kinder/Jugendlichen (sexualisierte) Gewalt erlebt haben – nur eben nicht durch die Person, die sie beschuldigt haben. Daher ist dem Schritt der Aufklärung der Hintergründe/Motivation noch einmal besondere Sorgfalt zu zuzuschreiben.
Dokumentation und weitere Aufarbeitung
Für den gesamten Rehabilitationsprozess ist eine umfassende Dokumentation durchzuführen, welche an die des Interventionsverfahrens anschließt. So sollten zum Beispiel getroffene Entscheidungen, Ergebnisse der Gesprächsrunden (insbesondere Vereinbarungen und Erwartungen für die zukünftige Zusammenarbeit) und Ideen für Veränderungen chronologisch erfasst werden.
Für Organisationen besteht unter Umständen Bedarf nach weiteren Maßnahmen nach innen und außen. Zum Beispiel kann es notwendig sein, dass eine Rehabilitation der Einrichtung oder Gesamtorganisation in der Öffentlichkeit notwendig ist. Hierfür sind weitere Schritte, insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, im Rahmen des Aufarbeitungsprozesses notwendig. Intern liefern sowohl das Interventions- als auch ein nachfolgendes Rehabilitationsverfahren möglicherweise nochmal wichtige Erkenntnisse in Bezug auf das Rechte- und Schutzkonzept. An welchen Stellen haben Strukturen nicht ineinandergegriffen oder waren diese für den Klärungsprozess hinderlich? Haben Arbeitsweisen, Konzepte oder Regelungen den Falschverdacht begünstigt? Somit können die Prozesse auch genutzt werden, um gegebenenfalls das Rechte- und Schutzkonzept anzupassen.
Das Rehabilitationsverfahren im Rechte- und Schutzkonzept
Eine umfassende und am Betroffenenwohl orientierte Bearbeitung der Vorfälle von sexualisierter Gewalt ist auf organisationale Kapazitäten angewiesen. Im Rahmen von Intervention empfiehlt es sich einen Leitfaden zu erstellen, der festlegt, wie diese Kapazitäten (im Sinne der Fallbearbeitung) bestmöglich eingesetzt werden (siehe auch den Baustein „Intervention“). Insofern hat der Interventionsplan präventiven Charakter, weil er eine Organisation auf eine mögliche Krisensituation vorbereitet und den Beteiligten Handlungssicherheit geben kann.
Gleiches gilt für die Festschreibung eines möglichen Rehabilitationsverfahrens im Rechte- und Schutzkonzept, auch wenn das Gelingen eines solchen Rehabilitationsprozesses nicht garantiert werden kann. Es wird sichergestellt, dass Ressourcen eingeplant werden, um sowohl die institutionelle Wiedereingliederung als auch die Wiederherstellung der Reputation einer Person zu ermöglichen, deren Falschbeschuldigung im Rahmen der Verdachtsabklärung zweifelsfrei festgestellt werden konnte.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei Verdachtsmomenten immer um individuelle Fälle handelt, die im Vorfeld schematisch nicht festgeschrieben werden können. Im Rechte- und Schutzkonzepte ist es daher auch nicht sinnvoll, einen umfassenden Rehabilitationsprozess unter Einbezug aller Ebenen zu beschreiben. Entscheidend ist in erster Linie die konzeptionelle Sicherstellung des Ressourceneinsatzes, die ein fachgerechter Rehabilitationsprozess benötigt.
Die Festschreibung eines solchen Rehabilitationsprozesses vermittelt die Sicherheit gegenüber Mitarbeitenden, dass die Organisation Verdächtigungen, die sich als fälschlich herausgestellt haben, ernst nimmt und im Sinne der Fürsorgepflicht weiterbearbeitet. Dadurch kann ein solches Verfahren dazu beitragen, dass Widerstände gegenüber dem Schutzprozess insgesamt abgebaut werden. Daher ist die breite Informationsweitergabe in die Organisation empfehlenswert und kann zum Beispiel bereits bei Neueinstellung thematisiert werden oder im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung vorgestellt werden.
Andererseits, und das ist im Sinne des Kinderschutzes nochmal besonders hervorzuheben, hat ein Rehabilitationsverfahren auch eine Signalwirkung auf Kinder und Jugendliche. Durch personenunabhängige und standardisierte Interventionsverfahren erleben Kinder und Jugendliche, dass Verdachtsmomente und Anschuldigungen von den Erwachsenen unvoreingenommen bearbeitet werden. Wenn sich darauffolgend ein Verdacht als unbegründet herausstellt und ein Rehabilitationsverfahren folgt, in dem die Perspektive von jungen Menschen weiterhin eine Rolle spielt, stellt dies nicht nur eine Wirksamkeitserfahrung dar. Es vermittelt Kindern und Jugendlichen gleichsam, dass auch unbegründete Fälle sexualisierter Gewalt nicht „unter den Teppich gekehrt“, sondern sorgfältig aufgearbeitet werden. Somit können auch Rehabilitationsverfahren dazu beitragen, dass eine Organisation zu einem verlässlichen und sicheren Ort für Kinder und Jugendliche wird.
Hinweis
In der Praxis zeigen sich häufig Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt, die sich nicht restlos aufklären lassen. In derartigen Fallkonstellationen ist die Einleitung eines Rehabilitationsverfahren nicht gegeben, da, die zweifelsfreie Ausräumung eines Verdachtes die notwendige Voraussetzung dafür ist. Verantwortliche müssen in solchen Fällen Überlegungen anstellen, wie es in dieser Situation weitergehen kann. Auch wenn gegenüber Mitarbeiter*innen unter Verdacht weiterhin Pflichten des Arbeitgebers bestehen, bleibt ebenso die Schutzverantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen bestehen. Der Schutz von jungen Menschen hat dabei immer Priorität. Zu diesem Thema empfehlen wir folgende Publikation, zum kostenlosen Download erhältlich: Kavemann, Barbara, Rothkegel, Sibylle, Nagel, Bianca: Nicht aufklärbare Verdachtsfälle bei sexuellen Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter*innen in Institutionen. Nicht 100 Prozent Sicherheit, aber 100 Prozent Professionalität, Berlin 2015, 81 Seiten.


 Köln, Juli 2022. Kinder und Jugendliche, die sich in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe aufhalten, müssen systematisch vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Mittel dazu sind Rechte- und Schutzkonzepte, die alle Ebenen einer Institution in den Blick nehmen und Risiken und Ressourcen zum Ausgangspunkt eines ganzheitlichen Maßnahmenpaktes machen. Einen kompakten Überblick zum Thema bietet der
Köln, Juli 2022. Kinder und Jugendliche, die sich in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe aufhalten, müssen systematisch vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Mittel dazu sind Rechte- und Schutzkonzepte, die alle Ebenen einer Institution in den Blick nehmen und Risiken und Ressourcen zum Ausgangspunkt eines ganzheitlichen Maßnahmenpaktes machen. Einen kompakten Überblick zum Thema bietet der 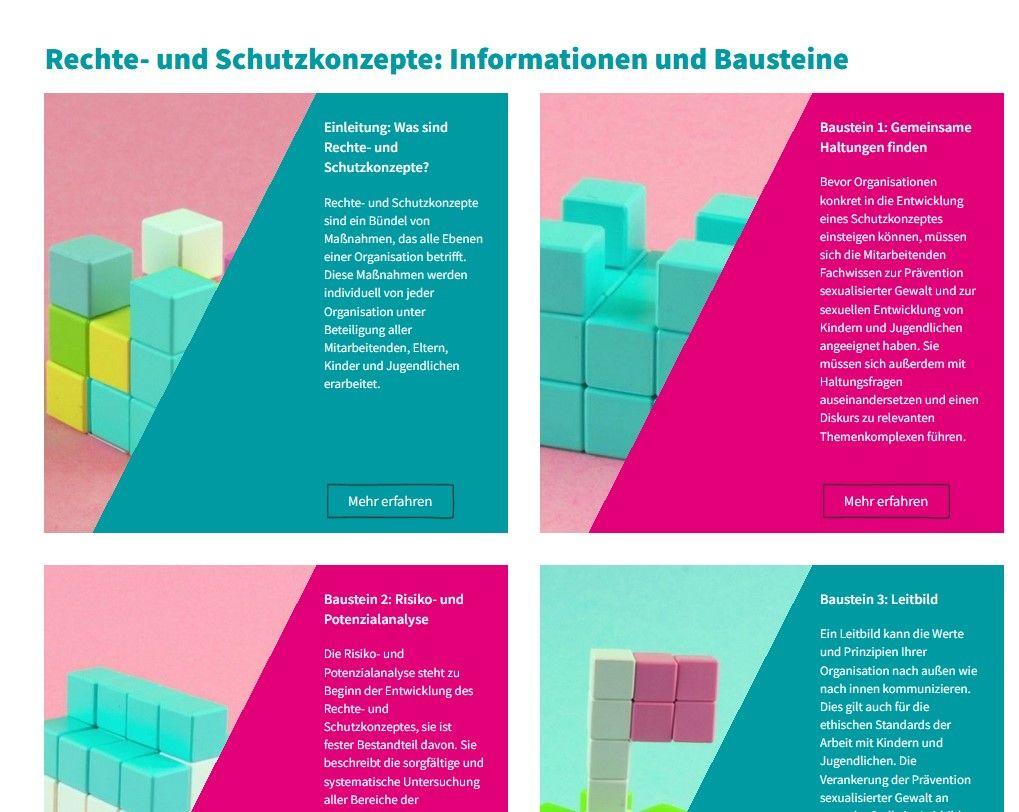
 Köln, den 03.05.2022. Die PsG.nrw hat eine neue
Köln, den 03.05.2022. Die PsG.nrw hat eine neue 
