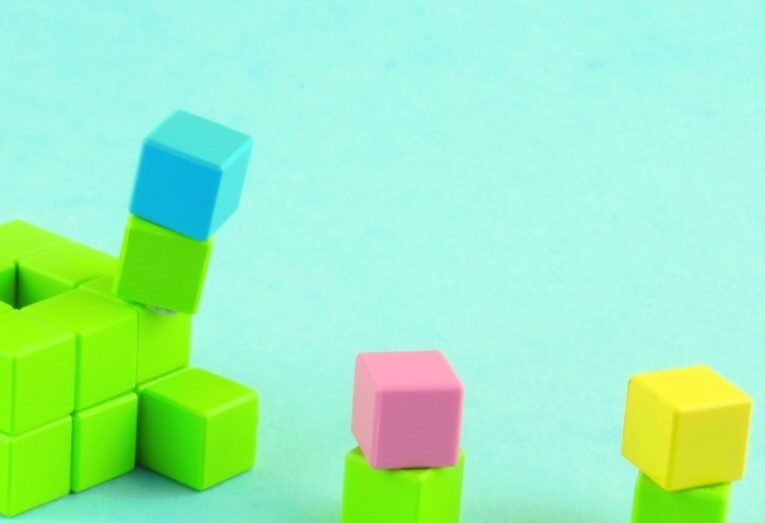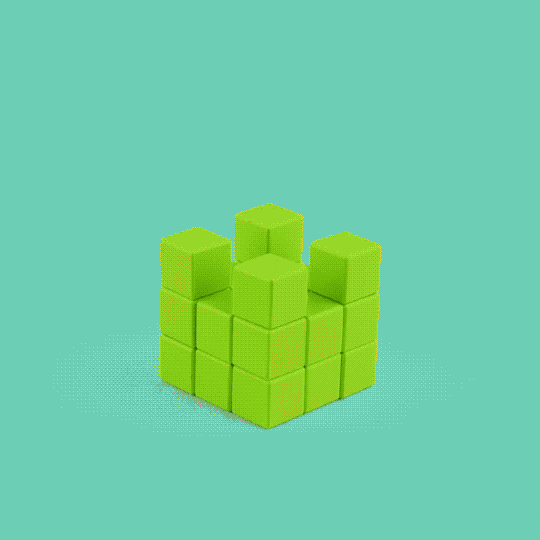Entscheidender Baustein von Schutzkonzepten ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in vielen Bereichen.
- In Form von alters- und bedarfsgerechter Information und Aufklärung: Kinder und Jugendliche haben Rechte und sollen das auch wissen. Wissen ist Macht. Und der Präventionsgrundsatz „Nur wer Bescheid weiß, kann auch Bescheid sagen“ muss hier Berücksichtigung finden.
- In Form von Beteiligung und Partizipation: Kinder und Jugendliche brauchen Selbstvertrauen, sollen ihre Meinung sagen, ernst genommen werden und an Entscheidungen beteiligt werden. Damit Partizipation auch im Rahmen des Rechte- und Schutzkonzeptes gelebt wird, sollten Kinder und Jugendliche von Anfang an in den Prozess mit einbezogen werden, denn sie sind ja die primäre Zielgruppe. Zum Beispiel kann mit Kindern und Jugendlichen eine Vereinbarung zur Mediennutzung oder eine für alle geltende Netikette zu ihrem Selbstschutz getroffen werden. Hier bietet es sich an, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen, nicht zuletzt, weil sie selbst Expert*innen sind. Aber: Die Verantwortung für die Prävention verbleibt immer bei den Erwachsenen!
- In Form von Beschwerdeverfahren: Kinder und Jugendliche sollen dazu ermutigt werden, ihre Anliegen selbst zu vertreten. Dabei helfen ein wertschätzendes, faires Miteinander, ein konstruktiver Umgang mit Konflikten und geregelte Abläufe.
Es gilt, die Rechte auf Befähigung und Partizipation, auf Information und auf Schutz miteinander zu vereinbaren. Das sind entscheidende Bestandteile einer präventiven Grundhaltung, die alle Beteiligten, allen voran die Kinder und Jugendlichen, verinnerlichen sollten.
Inhalte der entsprechenden Präventionsgrundsätze, die mit den Kindern und Jugendlichen partizipativ erarbeitet werden sollten, sind beispielsweise:[1]
- ein grenzwahrender Umgang miteinander
- eine „beschwerdefreundliche Haltung“
- der reflektierte Umgang mit Geschlechterrollen
- der reflektierte Umgang mit digitalen Medien
- die Berücksichtigung von Stärken und Schwächen junger Menschen im pädagogischen Alltag
Zudem sollte mit Kindern und Jugendlichen altersangemessen darüber gesprochen werden, was sexualisierte Gewalt ist, wie Täter*innen vorgehen, wie sie sich Hilfe holen können etc. Ein solches Informationsangebot sollte dabei keine Angst machen und nicht verunsichern, sondern Spaß bzw. Mut machen. Das geht, beispielsweise wenn es theaterpädagogisch aufgebaut ist, die Stärkung von Ressourcen in den Vordergrund stellt und sich an bestimmten Qualitätskriterien orientiert.[2] Entsprechende Empfehlungen finden Sie am Ende dieses Bausteins unter Literatur.
Hinsichtlich digitaler Aspekte sollten die Kinder und Jugendlichen außerdem konkret vertraut sein mit Einstellungen der Privatsphäre, Blockierfunktionen, Meldestellen etc. Zudem kann auch der Umgang mit Pornografie im Netz ein Thema sein u.ä.
[1] Vgl. Paritätisches Jugendwerk NRW (Hrsg.) und ISA (Institut für soziale Arbeit e.V., inhaltliche Ausarbeitung): Schutzkonzepte für die Kinder- und Jugendarbeit. Arbeitshilfe.Wuppertal 2021, S. 33 ff.
[2] Vgl. dazu DGfPI (Hrsg.): Qualitätskriterien für die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Jungen und Mädchen. Düsseldorf 2020.