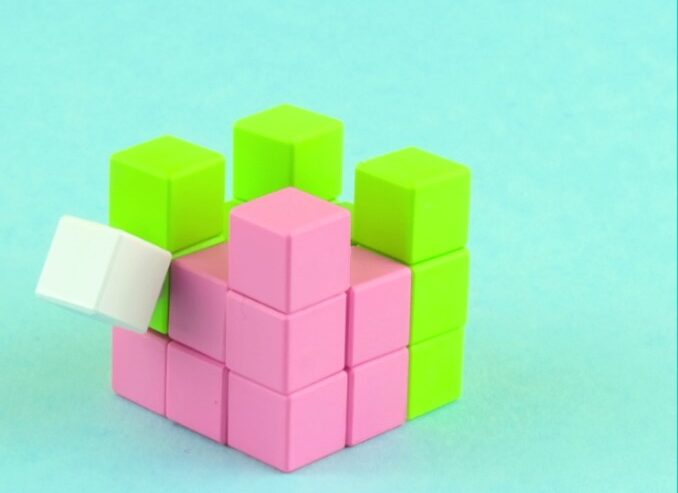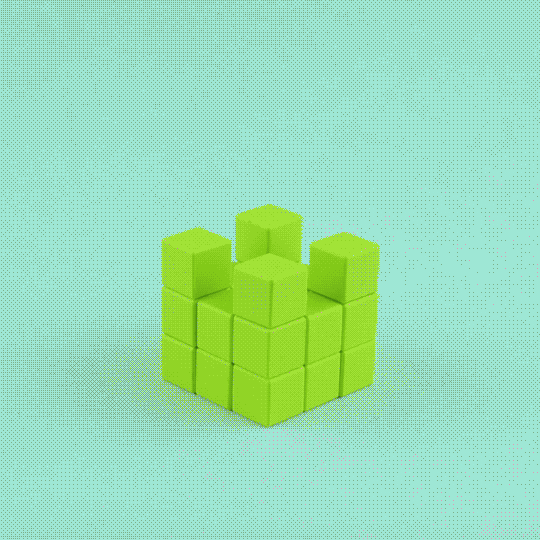Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind nicht nur für Betroffene mit psychisch-emotionalen Belastungen verbunden, sondern möglicherweise auch für Personen, die an der Intervention und Gewaltbearbeitung beteiligt sind. Neben der Versorgung von direkt und indirekt betroffenen Kindern und Jugendlichen spielt somit auch die Nachsorge mit Blick auf die erwachsenen Beteiligten eine wichtige Rolle.
Bei der persönlichen Aufarbeitung geht es darum, Beteiligte dabei zu unterstützen, das Erlebte zu verarbeiten. Bleiben Belastungen und negative Eindrücke zurück, besteht das Risiko, dass zukünftig Fälle von sexualisierter Gewalt nicht fachlich angemessen bearbeitet werden können. Für das Team geht es um die Überwindung des Schock-Zustandes, der häufig aus Fällen sexualisierter Gewalt resultiert, und eine Rückkehr in den Alltag der pädagogischen Praxis. Zudem soll langfristigen psychischen Belastungen oder Erkrankungen vorgebeugt werden. Daher ist es wichtig, diesem Prozess ausreichend Zeit und Ressourcen einzuräumen.
Im Rahmen von Inter- oder Supervision durch externe Personen bietet es sich an im Team / mit den Beteiligten über den Fall und dessen Bearbeitung zu sprechen:
- Wie erging es euch bei der Fallbearbeitung (z.B. in Gesprächssituationen mit Betroffenen)?
- Welche Gedanken, Ängste und Sorgen verbindet ihr mit dem Fall (z.B. eigene Schuld- und Schamgefühle)?
- Gab es Momente der Überforderung? Was hat euch geholfen?
Es ist möglich, dass der beschriebene Aufarbeitungsprozess für einzelne Beteiligte nicht ausreichend ist, um emotionale Belastungen zu bearbeiten. Auch bei helfenden Personen können sich Traumata ausbilden. Hierbei empfiehlt es sich Personen an externe, professionelle Hilfestellen anzubinden. Die Organisation kann dabei unterstützen, indem sie Einzelsupervision bereitstellt oder therapeutische Begleitung finanziell unterstützt.
Für die fachliche Aufarbeitung des Falls in der Organisation ist die Bearbeitung der psychisch-emotionalen Belastungen eine wichtige Voraussetzung.